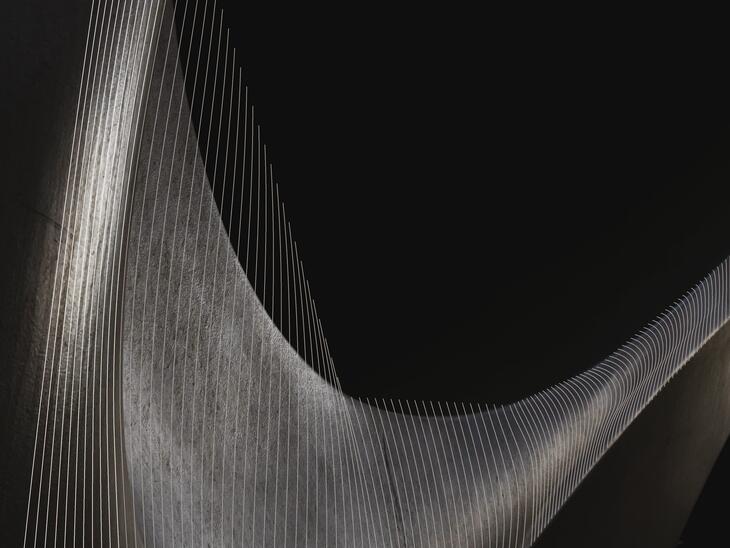Keine Zeit für Schonung und Umwege

Florentine Klepper und Kai Röhrig sprechen über ihre bevorstehende Produktion der beiden Einakter Der Kaiser von Atlantis und L´Hirondelle inattendue, die am 6. Dezember im Max Schlereth Saal Premiere feiert.
Warum fiel eure Entscheidung auf die beiden Einakter der jüdischen Komponisten Viktor Ullmann und Simon Laks? Spielte der geschichtliche Hintergrund „80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs“ eine Rolle?
Florentine: Ja und nein. Einerseits halten wir es für wichtig, mit unserer Klasse eine Musiktheaterproduktion immer auch im Kontext von aktuellen gesellschaftlichen Ereignissen und Diskussionen zu erarbeiten und ggf. auch in Bezug zu setzen. Andererseits stehen beide Werke musikalisch und inhaltlich für sich und sind auf tragische Weise zeitlos gültig. Sie „passen“ daher eigentlich immer und man würde den Komponisten unrecht tun, ihre Stücke lediglich auf ihre historische Entstehungsgeschichte zu reduzieren, wenngleich es in der Rezeption natürlich trotzdem immer mitschwingt.
Kai: Ich habe die Oper von Viktor Ullmann bereits im Jahr 2013 an der Universität Mozarteum dirigiert, gemeinsam mit der Regisseurin Julia Wissert, die damals bei Amélie Niermeyer studierte und seither eine beeindruckende Karriere als Regisseurin und Intendantin hingelegt hat. Schon damals hatte ich das Gefühl, dass gerade dieses Werk ein idealer Stoff im Kontext universitärer Musiktheater-Ausbildung ist: die Partien sind alle sehr gut mit jungen Stimmen besetzbar, das Orchester ist nicht groß, die eigentümliche Musik von Ullmann zwischen Tradition und (Wiener) Moderne, die schillernden Bühnenfiguren und natürlich vor allem der erschütternde historische Kontext, in dem die Oper entstanden ist, fesseln junge Menschen ganz unmittelbar. So stellt gerade die Arbeit an diesem Werk eine bewegende Erfahrung für unsere Studierenden dar und es entsteht musikhistorisches Bewusstsein im Kontext der kaum zu begreifenden Entstehungsgeschichte des Werkes. Ich habe erst neulich Peter Kellner von unserer aktuellen Produktion des Kaisers von Atlantis erzählt. Peter hat im Jahr 2013 als ganz junger Student am Mozarteum die Rolle des „Todes“ verkörpert. Inzwischen ist er seit vielen Jahren Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper und gastiert an allen bedeutenden Opernhäusern. Er meinte, dass ihn damals keine Rolle so nachhaltig als Sänger und Bühnendarsteller geprägt hat, wie Ullmanns „Tod“ und dass er diese Erfahrung immer mit sich tragen wird. Das ist doch berührend zu hören, wenn Studierende mit solch eindrücklichen Erlebnissen unsere Universität verlassen.
Sowohl thematisch als auch musikalisch sind beide Werke vollkommen unterschiedlich. Werden die zwei Opern dennoch auf irgendeine Art und Weise zueinander in Beziehung gesetzt, oder stehen sie jeweils für sich alleine?
Kai: Da gebe ich dir aus musikalischer Sicht nur bedingt recht. Bei allen Unterschieden gibt es durchaus auch ein paar Parallelen. Diese sehe ich z.B. im Einsatz von sogenannter „Unterhaltungsmusik“. Im damals aufkommenden Spannungsfeld zwischen U- und E-Musik spielte der Jazz und der Chanson auch im Oeuvre der beiden Komponisten eine nicht unerhebliche Rolle, was man beiden Einaktern unmittelbar anmerkt. Auch ein ähnlicher Umgang mit Tonalität und ein gewisser Eklektizismus ist beiden Komponisten zu eigen. Hier mal ein Tristan-Akkord, dort mal ein Zauberflöten-Zitat, hier etwas Mahler, dort etwas Ravel. Beide spielen mit formalen Traditionen und beide haben, vorsichtig gesagt, ein gespaltenes Verhältnis zur Avantgarde.
Florentine: Ich hoffe sehr, dass beides der Fall sein wird. Innerhalb des Teams haben wir nach inhaltlichen und ästhetischen Brücken bzw. Brüchen gesucht, die die Werke miteinander in Bezug setzen. Das beinhaltet z.B. die Entscheidung der Reihenfolge, in welcher wir die Stücke spielen, mögliche Überschneidungen im Personal (was sich durch Doppelbesetzungen automatisch einstellt) und gestalterische Parallelen. So spielen beide Stücke im selben Raum, der aber eine Entwicklung durchmacht, oder die Figur des Todes ist in beiden Stücken anwesend, obwohl sie bei Laks nicht vorgesehen ist. Gleichzeitig halten wir es für wichtig, beiden Stücken genügend Raum zu lassen, damit sie ihre ganz eigene Kraft entfalten können.
Viktor Ullman hat Der Kaiser von Atlantis 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt geschrieben. Für uns unvorstellbar, unter solchen Umständen ein Werk zu erschaffen, das musikalisch so brillant und durchzogen ist von schwarzem Humor. Wie seid ihr mit dieser Ambivalenz umgegangen, sowohl in der Vorbereitung als auch in der finalen Umsetzung?
Florentine: Die Annäherung war tatsächlich nicht ganz einfach, weil wir unsicher waren, welche Formensprache bzw. Spielweise überhaupt angebracht ist. Zuviel Respekt vor dem Stück ist aber auch nicht gut, dann findet man oft keine künstlerische Angriffsfläche. Hilfreich ist für mich letztendlich gewesen, mit der Ratlosigkeit in der Umsetzung von Themen dieser Tragweite offen umzugehen, sowohl innerhalb unserer Produktion als auch jetzt in der anstehenden Begegnung mit dem Publikum. Wir gehen sogar so weit, dass wir unsere Überforderung tatsächlich auch mit auf die Bühne nehmen und als Stilmittel verwenden.
In Simon Laks‘ L´Hirondelle inattendue geht es um Ausgrenzung und Mobbing, allerdings übertragen in das Reich der Tiere. Ein ganzer Zoo tummelt sich auf der Bühne. Welchen Unterschied macht es und welche anderen darstellerischen, aber auch interpretatorischen Möglichkeiten ergeben sich, wenn Arroganz und Eitelkeiten ins Tierreich übersetzt werden?
Florentine: Eine Fabel ist eine gängige Form des Gleichnisses, ohne zu direkt mit dem Zeigefinger aufeinander zu zeigen. Die Opéra-bouffe ermöglicht uns, mit einer gewissen Leichtigkeit absurde Vorgänge innerhalb einer Gesellschaft zu erzählen, die natürlich einen sehr tragischen Ursprung haben. In manchen Verhaltensweisen sind wir Menschen den Tieren ähnlicher als wir uns eingestehen möchten. Vielleicht sind wir bei einer Fabel manchmal eher bereit, uns eines Gedankens oder einer Wahrheit anzunehmen, weil mir als Rezipient*in ein humorvoller Spiel- und Assoziationsraum angeboten wird. Daher ist die Hirondelle inattendue in unseren Augen eine sehr geglückte Kombination zum Kaiser, der viel direkter, um nicht zu sagen unausweichlicher, mit Botschaften umgeht – „in your face“: Für Schonung oder Umwege hatte Viktor Ullman keine Zeit mehr.
Der Musikverlag Boosey & Hawkes hat für die Universität Mozarteum eine Kammerfassung von Simon Laks‘ Oper erstellt. Was ist das Besondere an dieser neuen Fassung? Wie wirkt sich die Reduktion der Orchesterstimmen auf die Sänger*innen auf der Bühne aus?
Kai: Tatsächlich war die Entstehung dieser Fassung eine ganz besondere Fügung. Ohne eine reduzierte Orchesterbesetzung hätten wir die Hirondelle im Kontext dieser Produktion auf keinen Fall aufführen können. Die originale Partitur ist ursprünglich für riesiges Orchester komponiert und dazu gibt es einen großen Chor. Im Gespräch mit Frank Harders-Wuthenow, dem Musikwissenschaftler und Senior Director bei Boosey & Hawkes, entstand die Idee zu dieser neuen Fassung. Ihm sind Schicksal und Musik von Simon Laks ein ganz besonderes Anliegen und ich hatte ihn schon früher mit bewegenden Vorträgen über Simon Laks erlebt. Er ist u.a. Herausgeber von Laks‘ autobiographischen Erinnerungen „Musik in Auschwitz“ und kämpft auch als Musikverleger für die Verbreitung seines musikalischen Oeuvres. Die eigens jetzt für unsere Salzburg Produktion entstandene Fassung nähert sich stark der schlanken Orchestrierung von Ullmanns Kaiser an: wenige Bläser, zwei Schlagzeuger, zwei Tasteninstrumente, ein Streichquintett. In dieser gelichteten Fassung klingt die Musik von Laks natürlich etwas weniger opulent, etwas weniger französisch-süffig und weniger dramatisch. Ich denke, dass trotzdem sehr viel von Laks‘ musikalischen Intentionen erhalten geblieben ist. Die schlankere Instrumentierung ermöglicht auch auf der Bühne Leichtigkeit und Delikatesse und trägt zum Charakter der „Opéra-bouffe“ bei, was das Werk ja vorgibt zu sein. Aber zwischendurch „kracht“ es auch mal ganz schön. Ich bin sehr gespannt auf die Erstaufführung unserer Fassung, die Tobias Leppert mit großem Einfühlungsvermögen erstellt hat. Beim „Chor der Tiere“ haben wir uns dafür entschieden, unseren „Tieren“ zusätzlich zu ihren Soli die – ohnehin nicht sehr umfangreiche – Musik des Chores zu geben. Auch unsere drei Kapitolgänse und ihr Kapitolgänserich haben so etwas mehr zu singen. Dadurch ist gerade diese Fassung der Hirondelle inattendue im besten Sinne ein Ensemblestück und ergänzt den Katalog der Kammeropern des 20. Jahrhunderts um einen funkelnden Edelstein. Dass wir im Kontext unseres Themenschwerpunktes und noch dazu erstmals in Kombination mit dem Kaiser von Atlantis an der Universität Mozarteum diese einzige Oper von Simon Laks aufführen können, erfüllt uns mit großer Freude.
Rund um die Opernvorstellungen gibt es einen umfassenden Themenschwerpunkt zum Leben und Leiden von Viktor Ullmann und Simon Laks mit Konzerten, Diskussionen, Vorträgen, Werkeinführungen und Filmvorführungen, der gemeinsam mit der Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserloos programmiert wurde. Welchen Mehrwert haben solche gemeinsamen Formate eurer Meinung nach?
Kai: Da die beiden Titel bereits Anfang des Jahres feststanden, haben wir uns bald danach an Yvonne Wasserloos gewandt und ihr von unserer geplanten Produktion erzählt. Sie war sofort Feuer und Flamme für einen gemeinsamen Themenschwerpunkt, welcher künstlerische Beiträge und wissenschaftliche Formate sinnstiftend verknüpft. Ebenso froh bin ich, dass unsere Kolleg*innen Pauliina Tukiainen und Eung-Gu Kim gemeinsam mit ihren Studierenden
Beiträge zum Konzertprogramm des Themenschwerpunktes erarbeiten werden. Auch Eric Chumachenco hat sich freundlicherweise bereiterklärt, Ullmanns drei letzte in Theresienstadt komponierte Klaviersonaten aufzuführen. So ist miteinander in kürzester Zeit ein Schwerpunkt entstanden, der wissenschaftliche und künstlerische Anteile verknüpft. Kunst und Wissenschaft im unmittelbaren universitären Dialog – anlässlich des erschütternden Themas ist das gerade in unseren Zeiten eine absolute Notwendigkeit und wir erhoffen uns große Resonanz.
Besonders freut uns, dass es nun noch eine Benefizvorstellung zugunsten des Vereins Gedenkdienst am Donnerstag, 11.12. um 11 Uhr vormittags geben wird. Der Eintritt zu dieser Aufführung ist kostenlos. Unsere Einladung richtet sich an Studierende und Schüler*innen ebenso wie an Pensionist*innen, an ehemalige Universitätsangehörige, an Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen und an alle Studierenden unseres Hauses. 11:00 Uhr vormittags ist sicherlich keine übliche Beginnzeit für eine Opernaufführung, aber wir verbinden gerade mit dieser Benefizaufführung aus gegebenem thematischen Anlass sehr viel und freuen uns über regen Besuch.
Zu den Terminen
-
Der Kaiser von Atlantis & L’Hirondelle inattendue In einer außergewöhnlichen Doppelaufführung bringt die Opernklasse von Florentine Klepper & Kai Röhrig zwei Opern auf die Bühne, die – mittelbar und unmittelbar – unter dem Eindruck von Verfolgung und Entrechtung im Dritten Reich entstanden sind. Ihre künstlerische Kraft bewegt und mahnt bis heute. -
Der Kaiser von Atlantis & L’Hirondelle inattendue In einer außergewöhnlichen Doppelaufführung bringt die Opernklasse von Florentine Klepper & Kai Röhrig zwei Opern auf die Bühne, die – mittelbar und unmittelbar – unter dem Eindruck von Verfolgung und Entrechtung im Dritten Reich entstanden sind. Ihre künstlerische Kraft bewegt und mahnt bis heute. -
11.12.202511:00 UhrMax Schlereth Saal
Der Kaiser von Atlantis & L’Hirondelle inattendue In einer außergewöhnlichen Doppelaufführung bringt die Opernklasse von Florentine Klepper & Kai Röhrig zwei Opern auf die Bühne, die – mittelbar und unmittelbar – unter dem Eindruck von Verfolgung und Entrechtung im Dritten Reich entstanden sind. Ihre künstlerische Kraft bewegt und mahnt bis heute.Oper· Eintritt frei! -
Der Kaiser von Atlantis & L’Hirondelle inattendue In einer außergewöhnlichen Doppelaufführung bringt die Opernklasse von Florentine Klepper & Kai Röhrig zwei Opern auf die Bühne, die – mittelbar und unmittelbar – unter dem Eindruck von Verfolgung und Entrechtung im Dritten Reich entstanden sind. Ihre künstlerische Kraft bewegt und mahnt bis heute.